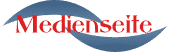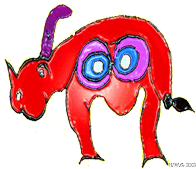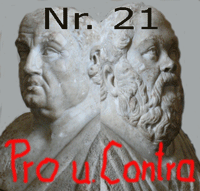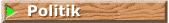









|
Rezension
BodoGaßmann
Kritik der historisch-hermeneutischen Methode
Rezension von:
Ottfried Höffe (Hrsg.): Die Nikomachische Ethik. Klassiker Auslegen. 4. neubearbeitete und ergänzte Auflage, Berlin/Boston 2019 (De Gryter).
An sich ist es verdienstlich, klassische Texte auszulegen. Studierende, die sich in das jeweilige Werk einlesen wollen, können neben dem Original (oder einer philosophisch kongenialen Übersetzung), das zu lesen Voraussetzung ist, Sekundärliteratur zum Verständnis zu Rate ziehen. Man muss nicht alles selbst entdecken, was in zweieinhalbjahrtausenden Interpretation herausgefunden wurde. Das Buch vom Herausgeber Höffe leistet jedoch kaum etwas zum Verständnis von Aristoteles‘ Ethik. Dieses negative Urteil gilt es an einzelnen Beiträgen zu demonstrieren. Dabei geht es mir nicht um formal Fragliches, wie die Tatsache, dass einige fremdsprachliche Texte übersetzt wurden, andere jedoch nicht, sondern um die grundsätzliche Frage, was eine Interpretation eines philosophischen Textes leisten kann oder wo sie weit hinter das Original zurückfällt und eher Verwirrung stiftet.
Höffes Methodenkapitel
Der Herausgeber wendet sich gegen eine „mit Metaphysik befrachtete Ethik“, das seien Elemente, derentwegen diese Ethik „als längst unzeitgemäß“ erscheine (S. 1). Was Metaphysik bedeutet, darin folgt er dem akademischen Mainstream, der darunter die „Theorie eines höchsten Seienden versteht“, eine Auffassung, die bei Aristoteles eher von seinen christlichen Interpreten hineingelesen wurde, als dass sie bei ihm eine relevante Bedeutung für die Ethik hatte. Für Höffe seien „Ethik und Metaphysik weitgehend unabhängig voneinander“ (S. 2), selbst Aristoteles gäbe sich „mit einer minimalen Metaphysik zufrieden“ (S. 2). Dies drückt Höffe in seinen anfänglichen methodischen Überlegungen so aus: „Gegenwärtig ist die Metaphysik allenfalls in jenem gewiß unproblematischen Sinn, daß die Ethik wie jede andere Disziplin allgemeine, jede Einzeldisziplin übergreifende Grundbegriffe verwendet.“ (S. 11) Zu diesen Grundbegriffen gehört die Frage, ob die Ethik der Politik oder die Politik der Ethik untergeordnet ist. Höffe vertritt die gewöhnliche Antwort: „die Politik gebietet, welche Kompetenzen zu lernen sind“ (S. 11), andererseits ist die höchste Lebensweise in der Ethik die „theoretische“, während die politische nur an zweiter Stelle steht. Solche methodologischen Überlegungen verzichten weitgehend auf die Argumente von Aristoteles, sondern vergleichen bloß Textstellen mit Textstellen. Dadurch ist die Methode etwas vom Inhalt des Textes Abgehobenes. Darin drückt sich der Zeitgeist aus, der Wissenschaftlichkeit vorwiegend an der Methode festmacht, negativ formuliert einen Methodenfetischismus huldigt. So lässt sich die „Methode“ auf die verschiedensten Gegenstände anwenden, hier der Vergleich von Textstellen. Dagegen muss rational mit Hegel darauf bestanden werden, dass „die Methode (…) das Bewußtsein über die Form der inneren Selbstbewegung ihres Inhalts“ sein muss (Logik I, Theorie Werkausgabe, S. 49). Eine solche Auffassung enthält für Höffe mit dem akademischen Mainstream bereits zu viel „Essentialismus“ (S. 11).
Demonstrieren lässt sich die Methodenproblematik an der Ungenauigkeit von ethischen Aussagen. Die hätten nach Höffe eine mangelnde Konsistenz, wären im Gegensatz zur Mathematik „bloßes Menschenwerk“ und hätten „eine gewisse Ambiguität“ (S. 17). Bei diesen Bestimmungen wird aber der Sache nach nicht zwischen dem „Grundriß-Wissen“ (S. 19), wie Höffe es nennt, und der Anwendung dieses ethischen Wissens unterschieden. Letzteres ist tatsächlich mit dem „Wagnischarakter der menschlichen Existenz“ (S. 18) verbunden, die wissenschaftlichen ethischen Bestimmungen dagegen können durchaus einen hohen Grad von argumentativer Exaktheit beanspruchen. Indem Höffe dazu nur den Syllogismus und die Induktion nennt (S. 16), unterschlägt er eine wesentliche Begründungsfigur von Aristoteles: den apagogischen Beweis. Danach ist es für Aristoteles selbstverständlich, dass es für die Polis als Gemeinschaft der freien mehr oder weniger autarken Bürger moralischer Regeln und Tugenden bedarf, um existieren zu können (wie bereits der Sophist Kritias exemplarisch vorgeführt hat, vgl. Capelle: Vorsokratiker, S. 378; zum apagogischen Beweis vgl. Aristoteles: Metaphysik 1006 a ff.).
Absehen von Metaphysik und die Folgen
Der Methodenfetischismus, abstrakte Negation von metaphysischen Aspekten und die anachronistische Eingemeindung von Aristoteles in die Gegenwart zeigt sich exemplarisch bei Ursula Wolf in ihren Kapitel 5 über die Mesoteslehre. Für Aristoteles ist das spezifisch Menschliche das begriffliche Denken, die Vernunft (nous), denn die unterscheidet den Menschen von den anderen Sinnenwesen. Also kann das gute Leben, die Glückseligkeit, auch nur in der theoretischen Lebensweise, der Betätigung der dianoetischen Tugenden bestehen. Diese Wesensaussage über den Menschen wird nun bestritten, indem sie zu Tatsachenaussagen empiristisch verwässert wird. Dann kann sie folgern: „Denn von der Tatsachenaussage, daß für Menschen die und die Tätigkeiten spezifisch sind, führt kein Weg zu einer Bestimmung des Gutseins als Mensch.“ (S. 67/Anm.) Wird die Bestimmung des Menschen auf Tatsachenaussagen heruntergebracht, dann ist die aristotelische Bestimmung der Glückseligkeit negiert, denn diese ist eine des anthropologischen Wesens des Menschen (wie problematisch auch immer). Dann kann Wolf auf die neuzeitlichen Glücksvorstellungen verweisen, die Glück als individuelles bestimmen (u. a. S. 80 f.). Ist dem aber so, dann fällt die aristotelische Ethik in sich zusammen und man hat statt Aristoteles die Ansicht von Wolf als Gegenstand. Dann kann sie auch sagen, dass die Tugend der Tapferkeit nichts mit dem guten Leben zu tun hat, da man dadurch sterben kann, wie es an anderer Stelle im Buch heißt. Das aber ist keine Aristoteles-Interpretation oder -Kritik, sondern eine neue, nämlich Wolfs „subjektive Konzeption vom guten Leben“, die nach „konsensfähige(n) Kriterien“ (S. 80) funktionieren soll, während bei Aristoteles Wahrheit objektiv ist, nicht auf Konsens beruht. Anstatt antike und moderne Ethik einander gegenüber zu stellen, wird Aristoteles umgedeutet zum modernen Ethiker, seine spezifische Leistung geht verloren. Die Zusammengehörigkeit der moralischen Tugenden (wie Tapferkeit) mit dem guten Leben wird von Wolf bestritten (S. 83). Das setzt wie der Tendenz nach der ganze Aufsatz von Wolf voraus, dass die aristotelischen Begriffe nominalistisch und empiristisch verwässert werden und die aristotelische Metaphysik abstrakt (d. h. ohne Argumente) negiert wird. Für Aristoteles dagegen beruht das gute Leben, die Menschen mögliche Glückseligkeit als theoretische Lebensweise auf der Muße, deren Bedingung die Polis ist. Diese ist nicht nur eine Anzahl von freien Individuen (Sklaven gehörten nicht dazu), sondern hat eine metaphysische Dimension. „Der Zusammenschluß einer kontingenten Vielheit von Freien wird in der politischen Gemeinschaft als Allheit (…) reflektiert. Nur die Polis als Ganzes, nicht der Einzelne für sich allein vermag autark zu leben., weshalb das Ganze ontologischen Vorrang gegenüber seinen Teilen hat: diese erfüllen ihrer Natur nach eine bestimmte Aufgabe (…) innerhalb der Polis, ohne deren Dasein sie als wesenlose Existenzen sind. Die Polis ist keine Gemeinschaft von Freien, die auch unabhängig von ihr existieren könnten.“ (Schmidt: Logik und Polis. Diss. Hannover, S. 23) Das setzt voraus, dass die Einzelnen auch mit der Tugend der Tapferkeit ihre Polis verteidigen. Sie opfern zeitweise Muße, um ihre Muße zu retten (vgl. Aristoteles: Politik, S. 1333 a ff.). Tapferkeit und allgemein die moralischen Tugenden sind dadurch ein integraler Bestandteil des guten Lebens, auch dann, wenn die Betätigung der dianoetischen Tugenden dem guten Leben angemessener sind. Ein Absehen von der Metaphysik (bzw. Ontologie) führt zwangsläufig zu Fehldeutungen.
Abstraktion von der sozialen Formbestimmtheit
Der Band von Höffe enthält unterschiedliche Beiträge, nicht nur was die einzelnen Aspekte betrifft, sondern auch im Hinblick auf unterschiedliche philosophische Konzeptionen, von denen her interpretiert wird. So enthält der Beitrag von Günther Bien durchaus eine brauchbare immanente Darstellung dessen, was Gerechtigkeit bei Aristoteles ist. Das generelle Manko dieser immanenten Interpretationen besteht aber in der Abstraktion von den sozialen Verhältnissen, die Aristoteles vor sich hat. Nicht dass nicht auch ökonomische Probleme einbezogen werden, aber ohne auf die Problematik der Herrschaftsweise bis in die theoretische Reflexion hinein hinzuweisen. So wird das Herr-Sklave-Verhältnis als fragloses unterstellt, aber nicht beurteilt. So wird auch nicht thematisiert, dass die Glückseligkeit, die in der betrachtenden (theoretischen) Tätigkeit des Seienden besteht, von der Brutalität der Sklaverei absieht, also auf Illusionen beruht oder sich modern gesprochen ideologisch verbiegen muss, um geistige Lust zu empfinden. Würde man diese Brutalitäten (ein Bergwerkssklave hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von fünf Jahren) einbeziehen, dann wäre es mit der Glückseligkeit als Übereinstimmung mit sich selbst vorbei, man könnte nicht in Freundschaft mit sich selbst leben.
Das Elend der Philologie, die sich als Philosophie aufspreizt
Philologie ist wichtig, um einen verstehbaren Text herzustellen, Übersetzungen adäquat zu erzeugen usw. Das setzt allerdings voraus, dass der Philologe, der einen philosophischen Text vor sich hat, auch philosophisch gebildet ist, wenn er Qualität liefern will. Versucht sich nun ein Philologe als Interpret von philosophischer Literatur ohne etwas von Philosophie zu verstehen, dann kann nur dümmliches Räsonieren herauskommen (etwa wenn mit dem moralischen Wertbegriff operiert wird (S. 78)). Nach Aristoteles muss die Wissenschaft zurecht zwischen Wesen und Erscheinungen, Substanz und Akzidenz notwendig unterscheiden, wenn sie einen konsistenten Gegenstand reflektieren will. Sonst gäbe es nur Erscheinungen, die auf andere Erscheinungen bezogen wären, Akzidenzien auf Akzidenzien – dies führt notwendig zu einem inkonsistenten Gegenstand, zu dem es keine wissenschaftlichen Aussagen geben kann. Denn Erscheinungen sind immer partikular oder singulär, lassen also keine Verallgemeinerungen zu. Diesen logischen Fehler macht sich Friedo Ricken schuldig trotz seines hochtrabenden Titels „Wert und Wesen der Lust“. Seine Methode besteht darin, alle möglichen Stellen in der Nikomachischen Ethik über Lust herauszuziehen, etwas über den jeweiligen Aspekt zu sagen, ohne den Begriff auf das Wesen des Menschen bei Aristoteles zu beziehen, an dem die Lust in ihrer Vielfalt akzidentell ist. Er will „das Wesen der Lust“ befragen (S. 166), aber Lust ist kein Substanz- oder Wesensbegriff. Bereits die Sprache verrät die Beliebigkeit des Gegenstandes: Es gibt diese Lust … und jene …, wahre Lust und scheinbare, niedere Lust und ranghöhere. Am aufschlussreichsten ist noch ein Aristoteles-Zitat, nach dem Lust von den Individuen unterschiedlich bis gegensätzlich beurteilt wird (S. 175); 1176 a – 12). Was Lust mit dem anthropologischen Wesen des Menschen als animal rationale oder als zoon politikon zu tun hat, muss sich der Leser aus dem Wust an zitierten Stellen selbst zusammensuchen.
Aristoteles und Kant – bei Höffe ein schiefer Vergleich
Der abschließende Beitrag des Herausgebers will zeigen, dass Aristoteles und Kant nicht soweit auseinander liegen, wie immer behauptet wird. Nun sagt Kant selbst, er habe keine neue Moral erfunden, sondern nur eine neue Formel (KpV, S. 113/Anm.). Aber es geht in diesem Sammelband nicht um moralische Regeln oder Tugenden, sondern um ihre Begründung, es geht um Ethik – und da ist die These von Höffe äußerst gewagt. Nun will Höffe weder einer Rearistotelisierung das Wort reden (S. 221) noch denen zustimmen, die Kant geschichtsvergessen als den modernen Ethiker ansehen. Sondern er will „die heute üblichen Typologisierungen“ (S. 222) und „wirkungsmächtige Gemeinplätze“ kritisieren und stattdessen „eine Reihe von Gemeinsamkeiten“ darstellen. Da sowohl Aristoteles wie Kant von praktischer Philosophie sprechen, suggeriert Höffe fälschlich, Kants reine Moralphilosophie habe bei Aristoteles eine Entsprechung – das aber ist falsch: Aristoteles geht von der Sitte in der Polis aus, deren Vernunft er reflektiert und daraus folgend die vernünftigen Tugenden begründet. Kant dagegen will ein reines Moralprinzip, weil die Sitten durch empirische Beimischungen verderbt sein können; der Tugendbegriff von Aristoteles als guter Habitus wird explizit von Kant verworfen, weil in jeder Handlungssituation der Bezug zum moralischen Gesetz neu und spontan geprüft werden muss. Deshalb kommt es Kant auf die Gesinnung an, die unser Handeln leitet.
Verallgemeinert besteht der entscheidende Unterschied von Aristoteles und Kant darin, dass ersterer metaphysisch vom Universalienrealismus ausgeht, während Kants Bestimmungen zunächst einmal nominalistische Termini sind, die nur dadurch objektive Geltung beanspruchen können, wenn sie transzendental (metaphysisch) deduziert sind, sich also der transzendentalen Einheit der Apperzeption (objektives Selbstbewusstsein) einfügen lassen. Dieser Unterschied ist einer ums Ganze, denn die aristotelische Moral kann immer nur innerhalb der jeweiligen Herrschaftsverhältnisse, die ihre Grundlage sind, gelten, während die apriorische Moral von Kant auch Kritik an Herrschaft (der kostenlosen Aneignung eines Mehrprodukts/Mehrwerts) überhaupt ermöglicht.
Positivismus als Interpretationsprinzip
Indem Höffe den Vergleich darauf beschränkt, was ist, unterschlägt er das Telos sowohl von Aristoteles, das gute Leben, wie das von Kant, ein universales „ethisches Gemeinwesen“, die beide nicht unter Herrschaftsverhältnissen zu haben sind. Auch die anderen Interpreten in diesem Band, ob wahr oder inakzeptabel, indem sie sich auf das beschränken, was war oder was ist, huldigen positivistisches Philosophieren. Was Höffe noch für Gemeinsamkeiten findet, sind oft nur formale Aspekte, dass beide universalistisch sind (S. 225 f.) (was bei Aristoteles seine Rechtfertigung der Sklaverei unterschlägt) oder keiner theologischen Begründung aufsitzen (S. 224) oder dass man Moral in der Praxis lernen müsse. Sie alle fügen sich in die bestehenden Herrschaftsverhältnisse ein und transzendieren sie systematisch nicht.
Die Rolle der Gesinnung
Am Begriff der Gesinnung lassen sich weitere Grenzen einer solchen Gleichsetzung erkennen. Für Kant ist die Gesinnung der entscheidende Begriff der Ethik, aus seiner Kritik der Tugend als guter Habitus folgt, dass für ihn Tugend „eine überlegte und feste Einstellung“ ist (Kant, zitiert nach Höffe, S. 224), oder in anderer Formulierung ist Tugend moralische Gesinnung im Kampf. Daß auch für Aristoteles die Gesinnung wichtig ist, ergibt sich schon daraus, dass er eine Ethik als Begründung von Moral oder moralischen Tugenden formuliert hat, denn die bestehende Sitte in der griechischen Sklavenhaltergesellschaft war auf Grund ihrer Antagonismen problematisch geworden. Handeln darf nicht nur legal sein, so Höffe, sondern muss auch mit einer rechten Gesinnung verbunden sein, denn sonst – so füge ich hinzu – ist es, wenn der gesellschaftliche Druck durch das Recht fehlt, keine stabile Haltung mehr. Dennoch bleibt ein gravierender Unterschied: ein fester moralischer Habitus bei Aristoteles in einer weitgehend statischen Gesellschaft – die Gesinnung als das alleinige Moralische bei Kant in der dynamisch sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft, in der Tugenden sich auch ins Gegenteil verkehren können (siehe dazu Gaßmann: Zur Geschichte der bürgerlichen Moralphilosophie, das Kapitel 8 über Mandeville).
Zusammenfassende Einschätzung der Aufsatzsammlung
Generell haben Interpretationen das Manko an sich, dass sie einen Begriff des Originaltextes (oder einer adäquaten Übersetzung) nur durch einen anderen Begriff deuten. Das aber ist letztlich redundant und es wäre besser, das Original zu lesen. Da Interpretationen nicht den ganzen Text verdoppeln, sondern auswählen, kommen in sie subjektive Tendenzen des Interpreten hinein, die nicht immer kenntlich gemacht werden, oft dem Interpreten selbst nicht bewusst sind – das aber ist ein Einfallstor für philosophische Moden, den wissenschaftlichen Mainstream und letztlich auch für Ideologien. Besser wäre hingegen die Form des Kommentars, der Zusammenhänge mit Vorgängern und Folgern beurteilt. Gelungen ist solch ein Kommentar, wenn die Dialektik von Genesis und Geltung dargestellt wird, d. h. der Fortschritt herausgearbeitet wird, den das Werk darstellt (vgl. Gaßmann: Zur Geschichte (Einleitung)). Da dies ein Telos der Entwicklung voraussetzt, ist ein solches heute im vorherrschenden Positivismus (die Beschränkung auf das, was ist) von vornherein ausgeschlossen. Positivismus ist in der Philosophie eine Auffassung, „die nach dem zu behandelnden Gegenstand eingerichtet wird“, sodass sie „von vornherein nichts anderes leisten kann als den Gegenstand unkritisch in theoretisierender Diktion zu wiederholen“ (Städtler: Manuskript). Dieser Positivismus, der immer bereits das bestehende Herrschaftssystem affirmiert, drückt sich in dieser Aufsatzsammlung aus als Methodenpluralismus, d. h. jeder allgemeine Gedanke wird toleriert, ob wahr oder offensichtlich falsch, wenn er im Rahmen der Affirmation bleibt. Dieser Pluralismus zeigt sich, indem die Autoren das begriffliche Erklären dem einfühlenden Beschreiben von Aussagen opfern. Alles wird auf beschreibende, am Text messende und quantifizierende Methoden reduziert, die sich den „Anschein der Wissenschaftlichkeit“ geben. Die Philosophie muss ihren gesellschaftlichen Ort finden, um überhaupt als „Disziplin“ bestehen zu können, d. h. sie muss ihre gesellschaftliche Funktion nachweisen können. (Diese Überlegungen sind angeregt durch Städler: Manuskript) Damit sie überhaupt eine Funktion im rationalisierten akademischen Betrieb ausfüllen kann, muss sie die Differenz zwischen wesentlichen Aussagen und Erscheinungen einziehen, alles wird gleich gültig und damit als gleichgültig dargestellt. Michael Städtler schreibt dazu: „Selbst die sich historisch-hermeneutisch definierenden Disziplinen, die ebenso um ihr Prestige ringen und sich ihre eigene Methode schaffen, laufen letztlich auf den Positivismus hinaus, indem sie das begriffliche Erklären von Zusammenhängen und Entwicklungen in der Geschichte dem einfühlenden Beschreiben von Fakten opfern“ (Manuskript) und dadurch theoretisch neutralisieren. Aus diesem Grund ecken sie nicht mit den Herrschaftsverhältnissen an und können bürgerliche Verlage finden und akademische Reputation erlangen.
Zurück zum Anfang
|
Wenn Sie beim Surfen Musikt hören wollen:

Weitere Internetseiten und unsere Internetpräsenz im Detail:

Audios, Fotos und Videos:
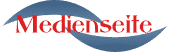
Die letzten Ausgaben der Erinnyen können Sie kostenlos einsehen oder herunterladen:



Erinnyen Nr. 18
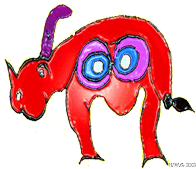


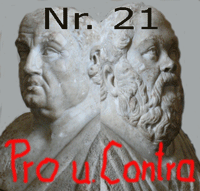
Nachrichten aus dem beschädigten Leben:

Unsere Zeitschrift für materialistische Ethik:

Unsere Internetkurse zur Einführung in die Philosophie:

Unsere Selbstdarstellung in Englisch:

Die Privatseite unseres Redakteurs und Vereinsvorsitzenden:

Unser Internetbuchladen:




|